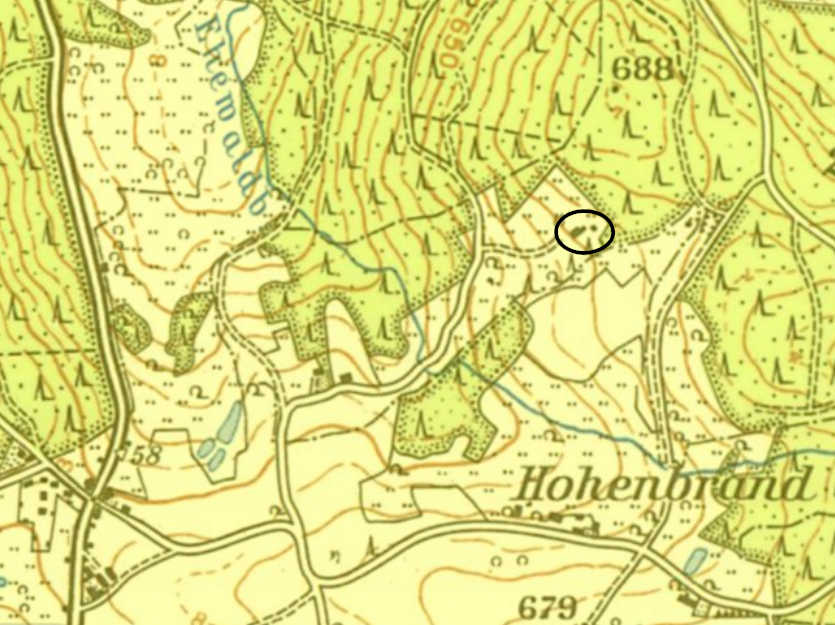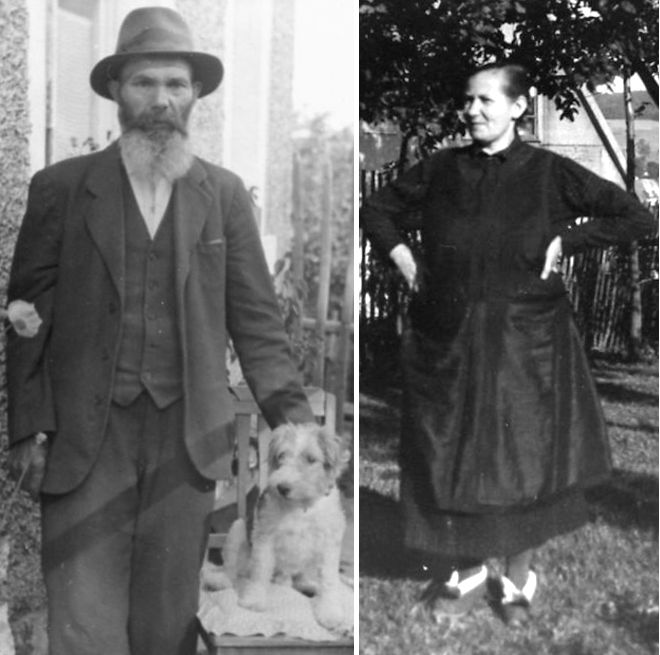| deutsch | So sagte man in Mühlbühl |
|---|
| Mühlbühl | Michbll (ohne ü) |
| Nagel | Nogl |
| Wurmloh | af da Wurmloh (auf der Wurmloh) |
| Lochbühl | Luach |
| Ebnath | Iamet (i-a-met) |
| Kemnath | Kemmet |
| Bayreuth | Baraat (aa ist hier ein langes a) |
| nach Bayreuth | af Baraat |
| Wunsiedel |
Wuaseggl (nicht Wousigl, wie es die Wunsiedler sagen) |
| Marktredwitz | Roawetz |
| nach oben, hinauf | affi |
| nach unten, herunter | oia |
| dort oben | druam |
| dort unten | drundn |
| herein, hinein | aichi, aini |
| heraus, hinaus | assa, assi |
| hinein in die Wohnküche | ai ind Stumm (Stube) |
| fünf Tage | fümbf Doog |
| fünfzig Jahre | fufzg Gaua |
| fünfzig-Pfennig-Münze | Fuchzgerl |
| meine Frau | mai Oidi (meine Alte) |
| meine Frau ist nicht gut drauf |
wannst suan Drachn dahoam host |
| mein Mann | der Olt (offenes O wie im englischen come) |
| eine dicke Frau | a Wamberte |
| der ist dick | dea hot a Wambn dro |
| lieber Gott | Himmivadderl (Himmelväterlein) |
| Brötchen | Loawla (Laiblein) |
| Tüte | Guggan |
| Topf | Hoofn |
| Kännchen, Tasse | Höferl (kleiner Hoofn) |
| viel / wenig | vui / weng |
| das ist zu wenig | des is a weng weng (ein bischen wenig) |